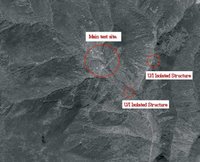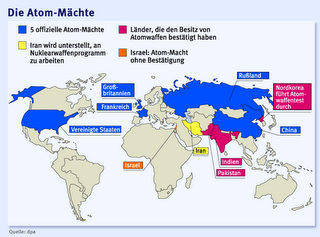Die Schweiz verbindet mit Deutschland (und Österreich und Liechtenstein) so einiges: da ist es die Sprache, die lange gemeinsame Geschichte. Da sind es die Wirtschaftsunternehmen und die Mentalität, die trotz vielfältiger Ausdifferenzierung einen gemeinsamen Grundstock haben. Was man den Deutschen nachsagt, Gründlichkeit und Genauigkeit, trifft ebenso auf Schweizer (und Österreicher und Liechtensteiner) zu. Und zwischenzeitlich gibt es auch eine Fluglinie: Lufthansa, Swiss und Austrian, eng verbunden und nur formal noch geteilt.
Aber wie sich das unter Geschwistern wohl gehört, gibt es ordentlich Zoff manchmal und das besonders. Und meist fühlt sich der kleine Bruder vom großen Bruder übervorteilt.
Kritik vom ,,großen Nachbarn‘‘ hören die Schweizer nicht gern.Und da liegt momentan so einiger Zoff in der Luft. Zum Beispiel: Zürich-Kloten. Für die Deutschen vor allem ein Ärgernis: die Lufthansa musste als Preis für die Übernahme ein drittes Drehkreuz neben München und Frankfurt/Main etablieren und den Großteil der An- und Abflüge geht über süddeutsches Territorium. Im letzten Jahr haben die Schweizer, vom großen Bruder im Norden übervorteilt gesehen, ein Abkommen im National- und Ständerat abgelehnt, welches einen stärkeren Ausgleich vorgesehen hat. Die Deutschen reagierten hart und beschränkten die An- und Abflugrechte für den wichtigsten Schweizer Flughafen drastisch.
(Süddeutsche Zeitung, 31.10.2006)
Nun soll es einen neuen Anlauf geben. Die Schweizer sehen in Zürich auch für das Badische einen wichtigsten Verkehrsknoten und Arbeitgeber und dafür sollen sie bitte auch einen Teil des Fluglärms aushalten. Die Deutschen sehen das ein wenig anders und so wird es wie immer wenn beide Seiten einen Teil der Wahrheit für sich verbuchen können auf einen Ausgleich ankommen.
Und da ist die Europäische Union. Sicher, die Schweiz ist Teil des EWR und hat zahlreiche bilaterale Abkommen mit der EU. Die lassen der Schweiz aber auch weitgehende Freiheiten wie zum Beispiel in der Gestaltung des Banken-, Stiftungs- und Steuerrechts und so urteilt der Chef des Schweizer Verbandes Economiesuisse, Rudolf Rahmsauer:
Die bilateralen Verträge mit der EU sind eine gute Basis für die Schweiz.Denn obwohl die Schweiz ihren überwiegenden Teil des Handels mit EU-Ländern abwickelt, Deutschland steht an erster Stelle aller Handelspartner, und quasi von der EU eingekreist ist, hat der eidgenössische Kopf so manche Ausnahmeregelung geschaffen. Diese ist für die Schweiz vorteilhaft.
(Süddeutsche Zeitung, 31.10.2006)
Gleichzeitig, für die Schweizer ein fortwährendes Ärgernis, sind EWR, EU und EFTA so eng miteinander verflochten, dass von einem aquis communitaire gesprochen werden kann. Und hier zeigen sich für die Schweizer die entscheidenden Nachteile: die EU legt die Standards fest, die im Rahmen des EWR schlicht zu übernehmen sind. Die Schweiz und die anderen EFTA-Staaten haben keine Mitwirkungsmöglichkeiten und aufgrund der engen Verflechtung der eidgenössischen Ökonomie mit der EU auch keine Wahlmöglichkeiten.
Daher ist es wohl nur eine Frage der Zeit, wann die Schweiz (und die anderen EFTA-Mitglieder) auch EU-Mitglieder werden. Faktisch sind sie es schon, bloss ohne Stimmrecht. Die Frage von Zürich-Kloten wird sich hoffentlich schneller klären lassen.
Und zwischenzeitlich tauscht man lustig Frotzeleien aus:
Bundestagspräsident Norbert Lamert: Die kumulierte Wachstumsrate der vergangenen fünfzehn Jahre sei in der Schweiz nur halb so groß wie in der Europäischen Union.
Rudolf Rahmsauer: Und im Moment wachse die Schweizer Wirtschaft schneller als jene der EU.
(Süddeutsche Zeitung, 31.10.2006)